-
Akkordrichtsatz Formel
Stundenlohn + Akkordzuschlag * Stundenlohn = Akkordrichtsatz
-
Minutenfaktor
= Akkordrichtsatz / 60 Minuten [€/min]
-
Stücklohnkosten
sind unabhängig vom Leistungsgrad
=Minutenfaktor * Vorgabezeit
-
Produktion als Faktorkombinationsprozess
- Produktionsfaktoren:
- 1. Zusatzfaktoren
- 2. Dispositive Faktoren
- 3. Elementarfaktoren unterschieden in Repetierfaktoren und Potentialfaktoren
- Repetierfaktoren = Verbrauchsfaktoren, also Faktoren die bei einmaligem Einsatz verbraucht werden
- Potentialfaktoren = Bestandsfaktoren, werden erst im Laufe der Zeit aufgebraucht wie Maschinen oder Gebäude)
-
Elemente des Produktionssystems
- Input = Einsatzgüter (Produktionsfaktor)
- Throughput (Produktionssystem im engeren Sinne = Transformation)
- Output = Ausbringungsgüter (Produkt)
-
Werkstatt: Organisation nach dem Funktionsprinzip
- Vorteile:
- Flexibilität bei Beschäftigungsschwankungen
- hohe Anpassungsfähigkeit
- geringe Umrüstzeiten /-kosten
- geringe Kapitalbindung
- Nachteile:
- Zwischenlagerbildung
- hoher Raumbedarf
- lange Warte- und Durchlaufzeiten
- schwierige Produktionsplanung und -steuerung
- Anforderungen an Mitarbeiter:
- Verantwortungsbewusstsein
- Leistungsbereitschaft
- Mitgestaltung
-
Fliessproduktion: Organisation nach dem Objektprinzip
- Vorteile:
- kurze Transportwege, geringe TKosten
- niedrige Durchlaufzeiten
- geringe Anforderungen an die Fertigungssteuerung
- Nachteile:
- hohes Kapitalrisiko
- hoher Kapitalbedarf / -bindung
- hohe Störanfälligkeit der gesamten Produktion bei Ausfall einzelner Maschinen
-
Kapazität erhöhen
- Beschäftigungsgrade erhöhen (Zeitarbeitskräfte, Urlaubssperre)
- Einsatzzeiten verlängern (Zusatzschichten, Überstunden)
-
Rentabilität
Erfolg/ Kapital
-
Order Penetration Point *
- bestimmter Zeitpunkt in der Prozesskette bei dem kundenspezifischer Auftrag erfasst wird
- bis OPP Produktion ist keinem konkreten Kunden zugeordnet (basiert auf reinen Absatzprognosen und integriert MtS = Push-Prinzip)
- ab OPP bestimmt ein kundenspezifischer Auftrag den weiteren Prozess in der Supply Chain (ab nun an Auftragsgesteuert und MtO = Pull-Prinzip)
Grundatz: Variantenbildung erst am Ende der Produktionskette
-
Rüstwertkoeffizient
= teilespezifischer Koeffizient, der angibt, wie groß der Anteil der Rüstzeit pro Teil an der Zeit pro Einheit höchstens sein darf
Damit wird eine Forderung an die Mindestgröße des Loses gestellt
-
Durchsatz
Losgröße/ Rüstzeit [Stück/ Minute]
-
funktionale Flexibilität
- breite Qualifikation der Mitarbeiter (jeder MA kann mehrere Maschinen bedienen)
- Job Enrichment, Job Enlargement
-
Phasen der Produktion
- Entwicklung mit CAD (virtuelle Planung)
- Produktionsplanung und Steuerung PPS (Fertigungs-, Auftragsdurchlaufsteuerung)
- Arbeitsplanung CAP (alle vorbereitenden Maßnahmen zur Fertigungsplanung)
- Fertigung CAM (Steuerung der Aufträge, Prüfung)
- Qualitätssicherung CAQ (Lieferanten Bewertung, Fähigkeitsuntersuchung)
-
Merkmalsausprägung bei der Vermögensstruktur
- Anlagenintensive Produktion
- Vorratsintensive Produktion (Schiffbau)
- Forderungsintensive Produktion
-
Nach welchen vorherrschenden Einsatzfaktoren unterscheidet man Produktionen?
- Materialintensive Produktion (Textilindustrie)
- Energieintensive Produktion (Herstellung Aluminium)
- Arbeitsintensive Produktion (Landwirtschaft, Manufaktur)
- Kapitalintensive Produktion (Luftfahrt)
-
Condition Monitoring
zeigt, in welchem Zustand meine Maschine ist
-
Materialfluss im Produktionssystem
- glatter Materialfluss (Walzwerk)
- konvergierender Materialfluss (Montageprozesse)
- divergierender Materialfluss (Destillation von Rohöl)
- umgruppierender Materialfluss (chemisch-technologische Umwandlungsprozesse)
-
Kontinuität des Materialflusses
- Kontinuierliche Produktion (Extrusion)
- Quasikontinuierliche Produktion = Taktfertigung (Spritzguß)
- diskontinuierliche Produktion = Chargenproduktion (Lebensmittel)
-
Faktoren des Wettbewerbsvorteils
- Wichtigkeit (muss ein für den Kunden wichtiges Leistungsmerkmal betreffen)
- Wahrnehmung (muss vom Kunden tatsächlich wahrgenommen werden)
- Dauerhaftigkeit (darf von Konkurrenz nicht schnell einholbar sein)
-
SWOT Analyse
- zur Strategieformulierung
- externe Chancen und Risiken
- interne Stärken und Schwächen
-
Economies of Scale
- Skalen-/ Mengeneffekte
- langfristige, durchschnittliche Stückkosten sinken bei steigender Produktionsmenge
- Nutzung bei konstanten Preisen oder bei gesunkenen Produktionskosten
-
Economies of Scope
Verbundeffekte
-
Hub & Spoke
- Hub = zentrale Kernfertigung
- Spoke = dezentrale, kundennahe Endfertigung/ Montage
Bsp.: Brötchen von Bäckereien
-
Fertigungsstrategien
- Make to Order MtO
- Make to Stock MtS
- Make to Plan MtP
-
Durchlaufterminierung
legt Start- und Endtermine der Arbeitsvorgänge unter Beachtung technologisch bedingter Arbeitsplatzfolgen fest
- Non adding value:
- Liegezeit
- Rüstzeit
- Transportzeit
- Kontrollzeit
- Adding value:
- Bearbeitungszeit
- Minimum: Summe der Arbeitsplatz Durchlaufzeiten entlang des kritischen Pfades (critical path method)
- Bearbeitungszeit: ca. 10-20% der gesamten Durchlaufzeit
- Liegezeiten (und andere unproduktive Zeiten): 80-90%
-
Praxisformen der Durchlaufzeiten-Verkürzung
- Eilaufträge: Priorisierung einzelner Aufträge (zu Lasten anderer Aufträge, führt zu Folgeproblemen)
- Splitting: Parallelbearbeitung eines Auftrags auf mehreren Maschinen (Beschleunigung von Prozessschritten)
- Überlappung: Produktionsbeginn bei Folgemaschine bereits, wenn Teile des Fertigungsloses noch auf der Vorgängerstation laufen
- Bündelung: Zusammenfassung gleichartiger Aufträge zu einem Los
-
Durchlaufterminierung mit dem Gantt-Diagramm
- logische und zeitliche Anordnung einzelner Aktvitäten eines Fertigungsauftrags entlang der horizontalen Zeitachse
- Arbeitsgang = ein Balken
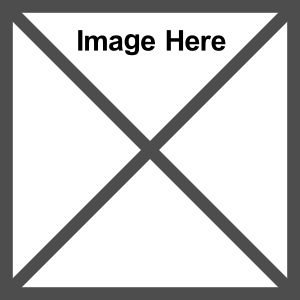
mittels Gantt Diagramm kann der früheste Endtermin bzw. der späteste Anfangstermin eines Fertigungsauftrags bestimmt werden
-
praxisrelevante Verfahren des Kapazitätsausgleichs
- Nachfrageanpassungen (Fremdvergabe oder Terminverschiebung unter Abstimmung mit Kunden)
- Kapazitätsanpassung (zeitl. Anpassung durch Mehrarbeit, Intensitätsmäßige Anpassung durch Erhöhung Geschwindigkeit)
- Kapazitätsglättung (Ausgleich durch Lageraufbau/ -abbau im Saisonverlauf)
-
Arbeitsflexibilisierung
- quantitativ: Personalaufbau/ -abbau, innerbetriebliche Umsetzungen
- zeitliche: Urlaubsplanung (chronologisch), Kurzarbeit/ Überstunden (chronometrisch)
- qualitativ: Job Rotation, Beförderungen
-
Belegungszeit
Rüstzeit + Ausführungszeit
- Rüstzeit = Rüstgrundzeit und Rüstverteilzeit
- Ausführungszeit = Zeit pro Einheit x Auftragsmenge
- Zeit pro Einheit = Grundzeit + Verteilzeit + Erholzeit
-
Ziele der Materialwirtschaft
- termingerechte Versorgung der Produktion mit den notwendigen Materialmengen in der erforderlichen Qualität
- geringe Kapitalbindung im Lager
- Nutzung optimaler Einkaufsmöglichkeiten hinsichtlich Preis, Menge, Termin und Qualität
- termingerechte Versorgung des Absatzmarktes mit Erzeugnissen und Ersatzteilen
-
Materialbedarfsarten
- Ermittlung nach Ursprung und Erzeugnisebene:
- Primärbedarf (Bedarf an verkaufsfähigen Erzeugnissen = Marktbedarf)
- Sekundärbedarf (Bedarf an Rohstoffen, Teilen und Gruppen zur Fertigung des Primärbedarfs)
- Tertiärbedarf (Bedarf an Betriebs- und Hilfsstoffen)
- Ermittlung unter Berücksichtigung der Lagerbestände:
- Nettobedarf (Bruttobedarf - verfügbarer Lagerbestand)
- Bruttobedarf (Periodenbezogener Primär-, Sekundär- oder Tertiärbedarf)
-
Materialbedarfsrechnung
= ermittelt aus Primärbedarf die benötigten Einzelteile, Zwischenfabrikate und Rohstoffe
-
Kanban
nachfrageorientierte Steuerung (Verbrauchs- bzw. Selbststeuerung)
-
qualitative Kapazität
Art und Güte des Leistungsvermögens einer Produktiveinheit, Streubereich der Produktqualität
-
Partieproduktion
- = Chargenproduktion
- Bei der Wiederholung des Produktionsprozesses ergeben sich in der Regel Qualitätsunterschiede der Endprodukte
-
originäre Produktionsfaktoren
= ursprünglich vorhandene Produktionsfaktoren
- Betriebsmittel (Geld- und Sachkapital)
- Geschäftsleitung
-
Abfallprodukte unterscheiden
- Prozessfehler (Ausschuss)
- Produkt-/ Prozessdesign (Randbeschnitt)
-
Kernelement des Total Quality Management
- Optimierung der Qualität von Produkten und Dienstleistungen eines Unternehmens in allen Funktionsbereichen und auf allen Ebenen durch Mitwirkung der Mitarbeiter
- Kainzen = ständige, mitarbeiterinduzierte Qualitätsverbesserung in Produkten und Prozessen
-
Taktik
= die operative (meist kurze) Planung um die langfristigen Ziele zu erreichen
-
Produktionsmanagement
- vereint die Disziplinen Produktionswirtschaft (Produktion) und Industriebetriebslehre
- Untersuchung und Erforschung aller Phasen der Produktion
-
Verfahrens- und Fertigungstechnik
- Verfahrenstechnik = physikalische/ chemische Umwandlung von Materie
- Fertigungstechnik = geometrische Gestaltung von Materie
-
Porters Five Forces
- Verhandlungsstärke der Zulieferer
- Bedrohung durch potentielle Mitbewerber
- Verhandlungsmacht der Kunden
- Bedrohung durch neue Ersatzprodukte
- Rivalität unter den Mitbewerbern
-
Baustellenfertigung
Produktionsfaktoren sind ortsgebunden (Fahrzeugmontage)
-
KANO Modell
Zusammenhang zwischen Erfüllung von Kundenwünschen und der Kundenzufriedenheit
-
Vorwärts- und Rückwärtsintegration
- Vorwärtsintegration = Übername einer oder mehrerer nachfolgender Fertigungsstufen (Handyhersteller eröffnen eigene Verkaufsflächen)
- Rückwärtsintegration = Übernahme einer oder mehrerer vorgelagerter Fertigungsstufen (Supermärkte stellen eigene Produkte her)
-
Unterschied Verteilzeit und Erholzeit
- Verteilzeit = Zeiten, die unregelmäßig und mit unterschiedlicher Dauer zusätzlich zur planmäßigen Arbeitsausführung anfallen
- Erholzeit = Dauer der Tätigkeitsunterbrechung, die zum Abbau der tätigkeitsbedingten Arbeitsermüdung erforderlich ist
-
ausgewogene Lohngerechtigkeit
- Leistungsgerechtigkeit
- Marktgerechtigkeit
- Bedarfsgerechtigkeit
-
Leerzeiten
- Leerzeiten (Maschinen) = Taktzeit - Summe aller benötigten Ausführungszeiten
- Durchlaufzeiten = Bearbeitungszeit + Wartezeit
- Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit + Leerzeit
- Wartezeit (Aufträge)
- Zykluszeit = Wartezeit + Durchlaufzeit + Leerzeit
-
Ziele JIT
- Verringerung Materialbestände
- Verringerung DLZ
- Erhöhung Arbeitsproduktivität
|
|